von
In einer Fernsehsendung aus den 60er Jahren, die sich „Was bin ich“ nannte, mussten die Vertreter einer Berufsgruppe eine bestimmte, typische Handbewegung machen. Warum sich Registrarinnen und Registrare damit schwer tun, erfahren Sie in diesem Artikel.
Es gibt Berufe im Museumsbereich, die kennt jeder. An der Spitze steht natürlich die Direktion. Eine Ebene darunter kommen dann die Kuratoren und Kuratorinnen. Dann gibt es noch technisches Personal und Leute in den Sekretariaten. Nicht zu vergessen jene Menschen, die in den Restaurierwerkstätten arbeiten und wieder andere, die für die Katalogproduktion zuständig sind. Marketing muss auch sein, Personalverantwortliche ebenso. In der PR-Abteilung sollten die Kommunikationsgenies sitzen und Wachpersonal ist in den Ausstellungsräumen permanent präsent. Auch Putztrupps sind ein Muss. Staub auf Gemälden und Skulpturen wird zwar von den Restauratorinnen und Restauratoren entfernt, aber auf Böden, Fenstern und Türen macht er sich auch nicht gut. Große Museen arbeiten mit Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittlern zusammen und dürfen sich auch eine eigene Bibliothek mit zugehörigem Personal leisten. Und dann gibt es noch eine Berufsgruppe, die bislang in der Öffentlichkeit überhaupt noch nicht bekannt ist. Das sind die Registrarinnen und Registrare.
Würde man auf der Straße nach diesem Berufsbild fragen, man würde Staunen auslösen, Unkenntnis ernten oder die Auskunft bekommen, dass diese Damen und Herren wohl in einer Behörde Schriftstücke verwalten würden. Und tatsächlich wird die Berufsbezeichnung auch für jene Personen verwendet, die in einer Registratur für die Akten zuständig sind. Sie geben Acht, dass die richtigen Akten ausgegeben und wieder eingestellt werden, kurz ihre Verwaltung eine Ordnung hat. Im Museum kümmern sich die Registrarinnen und Registrare aber nicht nur um Akten. Die gehören zwar auch dazu, aber im Fokus stehen die Kunstwerke selbst. Neben den Restauratorinnen und Restauratoren sind sie es, die direkt mit den Werken zu tun haben. Dabei deckt ihr Aufgabengebiet eine große Bandbreite von unterschiedlichsten Tätigkeiten ab.

Versicherungen müssen abgeschlossen werden (c) Zerbor
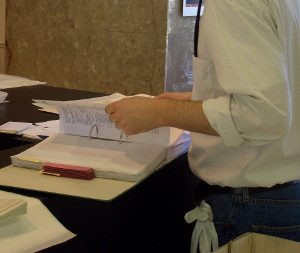
Genauigkeit ist ein Muss (c) Christiane Rainer
Ganz vorne auf dieser Liste steht der Leihverkehr. Etwas, womit das Publikum so gut wie nie in Berührung kommt. Außer man denkt an die großen, High-Tech-Lkw, die vor und nach einer Ausstellung bei den Museen vorfahren. Ihre Beschriftung lässt meist rückschließen, dass sie hoch sensibles Transportgut geladen haben. Es sind meist Holz- oder Aluminiumkisten, in denen die fragile Fracht steckt. Und bereits für diese Auswahl sind die Registrarinnen und Registrare zuständig. Auch dafür, wie das kostbare Gut darin verpackt wird. In Absprache mit dem Restaurierungsteam sind sie es, die mit den spezialisierten Frächtern kommunizieren und ihnen alles Wissenswertes über die Leihgeber und den Leihnehmer zukommen lassen. Das bedeutet, dass schon lange vor der tatsächlichen Ausstellung mit der Arbeit dafür begonnen werden muss. Stehen die Leihgeber fest, müssen Leihverträge ausgestellt, mit Versicherungen und auch den Speditionen Kontakt aufgenommen werden. Kostenvoranschläge werden eingeholt und verglichen. Und je nach Jobbeschreibung erweitert sich hier der Zuständigkeitsbereich von der kompletten Vorbereitung und Ausstellungsplanung bis hin zum Ausstellungsmanagement. Neben der schon kurz erwähnten Transportabwicklung gehört hier auch die gesamte Kommunikation und Korrespondenz, die Abklärung der Versicherung und der größte Brocken – das Management des Aufstellungsauf- und –abbaus dazu.

Kisten beim Ausstellungsaufbau (c) Christiane Rainer
Bei wichtigen Leihgaben wird sogar das Museum verlassen und mit den Leihgaben selbst die Reise angetreten. Dann verwandeln sich die Damen und Herren zu sogenannten Kurieren. Sie überwachen dabei den Transport live. Zuerst bei der Abholung, dann wieder bei der Zurückstellung. Das bedeutet in großen Institutionen zugleich auch große und weite Reisen. Flugangst oder Bedenken, mit einem LKW mitzufahren, sollte man in diesem Beruf also nicht haben. Und wer einen nine-to-five-Job sucht, ist hier auch nicht wirklich gut aufgehoben. Denn LKW fahren schon vor 8 und auch nach 17 Uhr und Flugzeuge sind permanent rund um den Globus unterwegs.
Da das Ausstellungsbusiness mittlerweile ein internationales ist, wird selbstverständlich von Fremdsprachenkenntnissen ausgegangen. Englisch Minimum. Spanisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch schadet auch nicht. Je mehr, umso besser. Aber mit Englisch, das auch das Fachenglisch einschließt, das in dieser Branche benötigt wird, kommt man schon weit.
Registrarinnen und Registrare müssen über den jeweiligen Aufenthaltsort der Objekte Bescheid wissen. Ob ein Stück gerade im Leihverkehr außer Haus, oder doch im Depot zu finden ist, sollte auf Anfrage innerhalb weniger Augenblicke klar sein. Dass es eigene Zollformalitäten gibt und staatliche Ausfuhrbestimmugen, die eingehalten werden müssen, auch das gehört zum weit gesteckten Wissensgebiet. Man könnte einen Vergleich mit Bibliothekaren von historischen Bibliotheken anstellen, nur dass sich die „registrars“, wie sie im Englischen heißen, nicht um die Verwaltung von Büchern, sondern von Kunstwerken kümmern. Das wesentlich vielfältigere Aufgabengebiet ergibt sich aus der unterschiedlichen Beschaffenheit der Objekte und dem Ausstellungsbetrieb selbst. Denn von klitzekleinen, kaum sichtbaren, bis zu tonnenschweren Schaustücken reicht die Bandbreite in diesem Sektor. So kommt, fragt man bei den zuständigen Damen und Herren nach den Tücken ihres Berufes, auch meist die Antwort, dass man flexibel sein muss, denn keine Ausstellung sei wie die andere. Bei jeder gäbe es neue Herausforderungen zu meistern und – wie es Lisa Ortner-Kreil vom Bank Austria Kunstforum formulierte: „Das Prinzip „Backe, backe Kuchen…wir machen eine Ausstellung“, funktioniert nicht.“ Sie wurde erst vor Kurzem von der Position einer Registrarin in die einer Kuratorin erhoben und spricht aus Erfahrung: „Der Rohstoff, mit dem wir arbeiten, ist der wertvollste der Welt und in diesem Job kann und darf es keinen Autopiloten geben. Es geht auch darum, verantwortungsvolle Entscheidungen „on the spot“ zu treffen; immer in Hinblick auf eine sinnvolle Verschränkung von inhaltlicher Relevanz und ökonomischer Machbarkeit.“

Anlieferung in Transportkisten

Manches Mal muss selbst Hand angelegt werden (c) Christiane Rainer

Transportkisten im Depot

Anlieferung mit Muskelkraft und Kurier
Damit spricht sie einen Punkt an, mit dem auch das Spannungsfeld des Berufes gut umrissen ist. Zwar wird bei jeder Ausstellung versucht, das Optimum an Bedingungen, sowohl beim Transport als auch schließlich im Museum selbst, zu gewährleisten. Es kann aber auch vorkommen, dass sich ein Kunstwerk als zu teuer für das Ausstellungsbudget herausstellt. Das hängt dann meist mit der Verpackung, dem Transport aber auch der Versicherung zusammen. Auch das muss dann an die Ausstellungsverantwortlichen kommuniziert werden.
Je kleiner ein Museum, umso vielfältiger gestaltet sich der Aufgabenbereich. Andrea Domanig von der Gemäldegalerie der Akademie der Bildenden Künste muss verschiedene Agenden bearbeiten. Sie ist Kuratorin, leitet die Digitalisierung der Sammlung und ist nicht zuletzt auch Registrarin. Viel mehr ist eigentlich nicht möglich. Christiane Rainer wiederum arbeitet freiberuflich. Als Selbständige wird sie gerne in Abteilungen gerufen, die eine temporäre Vakanz aufweisen. Aber sie arbeitet auch als eigenständige Ausstellungsmacherin und ist dann in diesem Fall von der Idee über die Planung bis hin zur Ausführung für alles zuständig.
So sehr auf der einen Seite die Vielseitigkeit der Beschäftigung steht, die für die meisten so interessant ist, so sind es auf der anderen Seite die administrativen Aufgaben, die ganz schön ermüdend sein können. Elendslange Listen schreiben, die Klärung von Rechten, Verhandlungen mit Versicherungen, die Pflege der Datenbank, wenn man hunderte ähnliche Objekte zu verwalten hat und sogar unkooperative Leihgeber stehen als richtige Herausforderungen auf der Kehrseite der Medaille. Da leuchtet ein, dass man ein Charakter- und Arbeitsprofil aufweisen sollte, das mit Genauigkeit, Ruhe und Gelassenheit, mit der Fähigkeit strukturiert zu arbeiten und mit Flexibilität aufwarten kann. Ungenauigkeit und Unzuverlässigkeit sind laut Else Prünster aus dem Leopoldmuseum unbrauchbar.
Sie plauderte in der Recherche zu diesem Artikel ein wenig aus der Schule und nannte als tolle Erlebnisse das Kennenlernen von Künstlerinnen und Künstlern genauso wie einst die Aufregungen rund um den geschlossenen Channel nach England oder den wetterbedingten Widrigkeiten während eines Transportes, der rasche Entscheidungen erforderte.
 Eine Ausbildung gibt es bislang noch nicht. Aber Vereine wie das ARC, das Austrian Registrars Committee, in dem sich viele Registrarinnen und Registrare österreichischer Museen und Sammlungen, aber auch Museen und Transportunternehmen zusammengeschlossen haben, sehen zumindest eine Mitwirkung an einem eigenen Berufsbild als ihr Ziel an. Von Vorteil ist es jedoch, wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Archiv-, Bibliotheks-, Informationswissenschaft, Museologie, Archäologie, Kunstwissenschaft oder Kunstgeschichte, oder dem jeweiligen museumsspezifischen Fachgebiet vorweisen kann. Die Aufgabenbereiche können in diesem Beruf je nach Arbeitsstelle sehr differieren.
Eine Ausbildung gibt es bislang noch nicht. Aber Vereine wie das ARC, das Austrian Registrars Committee, in dem sich viele Registrarinnen und Registrare österreichischer Museen und Sammlungen, aber auch Museen und Transportunternehmen zusammengeschlossen haben, sehen zumindest eine Mitwirkung an einem eigenen Berufsbild als ihr Ziel an. Von Vorteil ist es jedoch, wenn man ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Archiv-, Bibliotheks-, Informationswissenschaft, Museologie, Archäologie, Kunstwissenschaft oder Kunstgeschichte, oder dem jeweiligen museumsspezifischen Fachgebiet vorweisen kann. Die Aufgabenbereiche können in diesem Beruf je nach Arbeitsstelle sehr differieren.
Das ARC richtet im Juni 2016 in Österreich die European Registrars Conference aus. Eine fachspezifische Veranstaltung, zu der Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt in der Hofburg erwartet werden. Der Austausch mit ihnen steht auf der Wunschliste der Registrarinnen ganz oben. Von andern lernen, sich vernetzen, ist ein wichtiger Punkt, der von allen, die in diesem Beruf arbeiten, angesprochen wird. Wenn Sie diesen Artikel bis hierher aufmerksam gelesen haben, wird es Ihnen nicht entgangen sein, dass plötzlich nur von weiblichen Registrarinnen die Rede ist. Tatsächlich ist es so, dass die Männer in der Minderheit agieren. Und das weltweit. Woran das liegt, darüber mag man spekulieren. Auf alle Fälle ist diesem Umstand sogar ein eigener Tagesordnungspunkt auf der Konferenz gewidmet.
Auch wenn sich vieles glänzend und aufregend anhört, so gibt es doch noch einen Wermutstropfen, der bei dieser Berufsverkostung ein wenig bitter schmeckt: „Das Sozialprestige dieser Funktion ist innerhalb der teils sehr hierarchisch gewachsenen Gefüge von Museen leider immer noch nicht gut. Registrars werden zum Teil als kleines Rädchen gesehen – „füllen eh nur bestehende Verträge aus“, so Christiane Rainer, eine der treibenden Kräfte des ARC. Gefragt, ob Sie diesen Beruf dann jungen Leuten nicht empfehlen würde, relativiert sie: „Davon würde ich mich nicht abschrecken lassen, denn das ist im Wandel begriffen.“ Einen Baustein dazu soll nicht zuletzt auch die Konferenz im Juni dieses Jahres leisten. Sicherlich kommt es bei der Wertschätzung ganz auf die jeweilige Institution an. Else Prünster ist mit ihren Aufgaben im Leopoldmuseum sehr zufrieden. „Wenn man eine Leidenschaft für Kunst hegt, ist dies ein Traumjob“, schwärmt sie von ihrer Arbeit und ergänzt, dass sie ein langfristiges Ziel verfolgt, das sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen uneingeschränkt teilt: „Sammlungsobjekte und Sammlungen für die Zukunft zu erhalten und zu bewahren.“ Von dieser Warte aus gesehen, kann man allen, die in diesem Job arbeiten, gratulieren, denn es gibt wenige Berufe, die mit mehr Sinn aufgeladen sind wie der einer Registrarin oder eines Registrars.
Warum sich diese Damen und Herren schwer tun, eine repräsentative Handbewegung zur Erkennung ihres Berufes zu machen, kann man verstehen. Oder wüßten sie eine?
Dieser Text ist im Jänner 2016 für European Cultural News entstanden.

